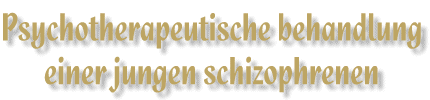

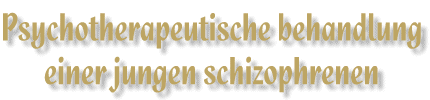 |
 |
|
Es ist für mich undenkbar den Fall von Laura ebenso lobpreisend zu kommentieren wie das Buch von Marie-Andrée Sechehaye und den Film von Nelo Risi über den Fall von Renée. In der Tat, gleichzeitig den Platz des Autors und des Kritikers einzunehmen, würde darauf hinauslaufen Parteinehmender und Richter zu sein, wie man in Frankreich sagt. Dies ist eine Übung zu der ich mich nicht erkühnen würde. |
|
Diesen Darstellungsraum zu nutzen, um über die Möglichkeit der Entwicklung des Falls von Laura zu sprechen, ist anderseits eine Aufgabe, der ich mich nicht entziehen sollte. Um so mehr als die Leitung der psychotherapeutischen Behandlung in meinem Leben einen Raum in Anspruch genommen hat, dessen Außmaße ich bis heute, fünfzehn Jahre nach unserem ersten Treffen, immer noch nicht erfaßt habe. Der Fall von Laura ist quasi eine Antwort auf den beinahe identischen Fall von Renée. Das heißt, daß die therapeutische Behandlung nach 50 Jahren zu einem ähnlichen Resultat geführt hat. Das klingt wie eine Herausforderung an die psychoanalytische Forschung des letzten halben Jahrhunderts, und als ob die Inspiration von Frau Sechehaye nichts von ihrem ersten Elan verloren hätte. Somit standen die ins Spiel gebrachten Faktoren rund um den Fall von Laura im Zusammenhang mit dem Kontext, der sich rund herum um die Geschichte von Renée entwickelt hat, obwohl die sie trennende Zeit lang erscheinen könnte.
Der Rückgriff auf die Handlung als therapeutischer Verfahrensweise und die Demonstration ihrer therapeutischen Wirksamkeit entsprach in dem psychoanalytischen Klima der Zeit von Frau Sechehaye einem extrem gewagten Vorgehen. Darüberhinaus hatte dies eine wirkliche Verführungswirkung auf die Öffentlichkeit.
|
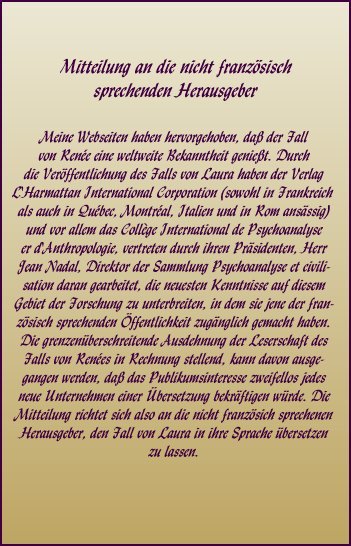 |
|
Die Reaktionen waren seitdem folglich übertrieben, doppeldeutig sogar ambivalent und ziemlich leidenschaftlich. Aus den vielen Stimmen haben sich in der Presse zwei Ströme herauskristallisiert: Jene, die die Geschichte von Renée aus Überzeugung angenommen haben und die sich mit Frau Sechehaye identifiziert haben: Ich hätte das selbe getan. Und jene, die zurückhaltender und vorsichtiger versucht haben, der Verführungswirkung zu widerstehen, indem sie sich an die Texte von Freud hielten und erklärten, daß, wenn ein Pflegeunternehmen darin bestünde, alte Mängel im Nachhinein zu lindern, die noch immer unerfüllt sind, so würde das die Psychoanalyse trotzdem reduzieren: der Artikel von Henri Chapier in Combat vom 24. Oktober 1969 ist hierfür ein sprechendes Beispiel. |
|
Mit diesen doppelt widersprüchlichen Reaktionen ist die Geschichte von Renée folglich mit einem gewissen Unbehagen in der Welt der Psychatrie aufgenommen worden, das man als klinisch-theoretisches Unbehagen bezeichnen könnte, und dessen Wirkung der Geschichte von Renée eingebracht hat, ungerechterweise vergessen worden zu sein, um mit den Worten des Lyonnaiser Psychaters Jacques Hochmann in Techniques de soin et psychatrie de secteur (Pflegetechniken und Sozialpsychatrie) zu sprechen. |
|
Durch die Tatsache in das Abenteuer hineingezogen worden zu sein, den Fall von Renée wieder aufzunehmen, konnte ich nicht natürlich nicht anders als für dieses anfängliche Unbehagen noch mehr sensibilisiert worden zu sein, zur gleichen Zeit von außen durch das, was Renée betrifft, und von innen durch die Arbeit mit Laura. Durch meine Arbeit mit Laura und ihrem Bezug zur Geschichte von Renée, dachte ich ein wenig naiv, daß man es zugestehen sollte, daß der Fall von Laura nur von der vergangenen Anerkennung profitieren könnte. Tatsächlich hat sich das, was ich wie ein Trumpf angesehen habe, eher als eine Achillsverse enthüllt. Renée wurde zu ihrer Zeit mit Weihrauch bestreut. Achtzehn Jahre später hatte sie sogar das Glück - dank dem Talent eines Filmemachers, der von ihrer Geschichte fasziniert war - wieder neu aufzuerstehen, aber dieses Privileg hatte letzten Endes nur dazu beigetragen, sie noch mehr einzubalsamieren, die anfängliche Verschließung zu verlängern und die Dekonstrukion und Auflösung des klinisch-theoretischen Unbehagens, daß ihr Fall am Anfang in Gang gebracht hatte, zu verhindern. |
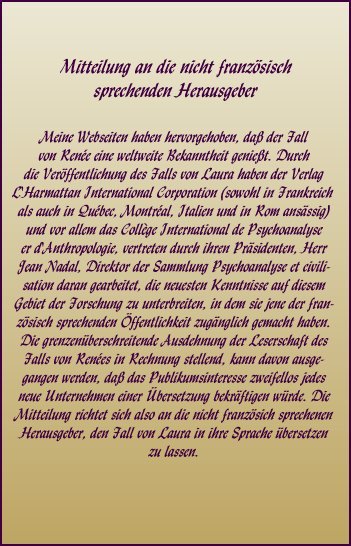 |
|
In Anbetracht der Bedeutung dieser Problematik, habe ich meine Einführung in die theoretische Annäherung gemacht, die dem Fall von Laura (Psychotherapeutishe Behandlung einer jungen Schizophrenen; theoretischer Kontrapunkt) nachfolgen wird, und obgleich ich kaum in der Lage bin, weiter zu gehen, möchte ich dennoch, einige erstaunlich interessante Elemente als Schlußfolgerung zu dieser Darstellung aufzählen. Dabei bin ich mir des Risikos bewußt, kurz und bündig zu sein. |
|
Im Laufe jeder der Etappen der Psychotherapie hat es sich erwiesen, daß einzig und allein die verabreichten Handlungen in einem Abstand von anderthalb Jahren eine therapeutische Wirkung erzielten: die Gabe von Wasser, die Lektüre in der Sitzung, das Geschenk des Hundes. Aber über dieses Ergebnis hinaus wird es möglich sein, die Analyse des besprochenen klinisch-theoretischen Unbehagens zu vertiefen. Obwohl ich mich auf die Theorie der Psychoanalyse gestützt habe, habe ich sie dennoch nicht auf technischer Ebene benutzt. |
|
In anderenWorten, rein theoretisch hätte jeder andere in einer gleichen Situation dieselben Handlungen in ähnlichen Perioden verabreicht, mit oder sogar ohne wirkliche theoretische Stütze, wäre er zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Die Wirksamkeit der Pflege stimmt also nicht mit den Mitteln überein, die mich dazu geführt haben, die Handlungen zu verabreichen. Diese Abweichung führt nicht einmal dazu, daß theoretische Modell, das wir benutzt haben, um diese Wirksamkeit zu erreichen, zu bestätigen. Dieses Paradox ließ mich zuerst in ein persönliches Unbehagen stürzen. Es hat mich gezwungen, zugeben zu müssen, daß die Ergebnisse weder auf meine subtilen Interpretationen hinwiesen, noch auf meine geschickte Ausästung der Abwehrmechanismen, noch auf meine tiefgründigen Analysen der Gegenübertragung, noch auf eine Kenntnis der Technik der psychotherapeutischen Pflege. Aber es wurde notwendig, dieses Unbehagen zwischen Laura und mir zu überschreiten und mit dem oberhalb liegenden klinisch-theoretischen Unbehagen in Verbindung zu bringen, um fähig zu werden, dieses Unbehagen auf der zweiten Ebene, das von der Mehrheit des Pflegepersonals empfunden wurde, aber nicht beschrieben werden konnte, zu entdecken und zu analysieren. |
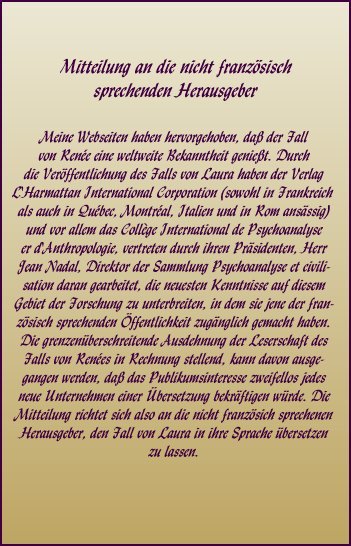 |
|
Es ging also nicht nur um eine paradoxe Pflege (wie es Techniken paradoxer Befehle in systemimmanenter Theorie gibt oder die Art wie Victor Frankl in Wien praktizierte), sondern um eine paradoxe Heilung, bei der jeder zerissen war zwischen der Offensichtlichkeit der Wirksamkeit der Pflege und des Mangels an Mitteln, sich deren Mechanismen vorzustellen. Natürlich bin ich nicht an diese Stelle stehen geblieben. Ich lade all jene, die in der Analyse des Falls von Laura noch weiter gehen wollen ein, mir ihre persönlichen Daten durch e-mail zukommen zu lassen, damit ich sie im gegebenen Moment von der Fortsetzung meiner Recherchen in Kenntnis setzen kann.
|
|
| Index| Webmaster |
© SCHIZOWEB, 2000 — Tous droits de reproduction interdits. |